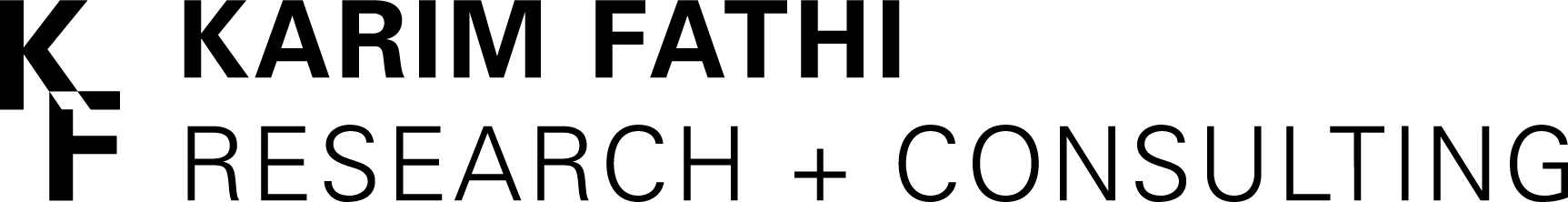Forschung
Komplexe Zusammenhänge interdisziplinär verstehen
WISSEN-SCHAFFT MEHR DURCHBLICK
Interdisziplinäre Forschung zu komplexen Themen
Meine Hintergeschichte: Vom leidenschaftlichen Streber zum begeisterten Komplexitätsforscher und Organisationsberater
Während meiner Schulzeit hätte ich nie gedacht, dass ich einmal als leidenschaftlicher Forscher komplexer Zusammenhänge unterwegs sein würde. Voller Begeisterung begann ich mein sozialökonomisches Studium an der Universität Hamburg, um große philosophische, sozial- und geisteswissenschaftliche Fragen – und dabei auch mich selbst – besser zu verstehen. Noch mehr faszinierte mich jedoch, wie unterschiedlichste Fachbereiche miteinander vernetzt sind und so ein umfassender Blick auf komplexe Systeme entsteht.
Ein prägendes Schlüsselerlebnis hatte ich 2005 im Masterstudium „Friedens- und Konfliktforschung“ an der Philipps-Universität Marburg: In einem Kurs zur Analyse des Zypernkonflikts wurden wir in Gruppen aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche theoretische Perspektiven vertraten. Statt die Positionen gegeneinander zu verteidigen, wurde mir schnell klar, dass sich diese Sichtweisen ergänzen – und dass es sinnvoller wäre, sie zu integrieren, anstatt zu debattieren.
Das stellte für mich wichtige Fragen in den Mittelpunkt: Wie lassen sich unterschiedliche Fachperspektiven theoretisch und praktisch zusammenführen? Welche Strategien gibt es für den Umgang mit komplexen, unvorhersehbaren Problemen? Und wie können interdisziplinäre Kommunikationsprozesse gestaltet werden, damit sie zu höherer kollektiver Intelligenz und besseren Lösungen führen?
Aktueller Fokus: Komplexe Probleme lösen, Multiresilienz stärken, friedliche Konfliktlösung
In Zeiten vielfältiger globaler Herausforderungen – in Form komplexer Krisenbündel und -kaskaden – sind diese Fragen wichtiger denn je. Ob in Forschungsgruppen, Think Tanks, der Produktentwicklung oder im Projektmanagement: Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen arbeiten gemeinsam an komplexen Aufgaben. Dabei braucht es vor allem disziplinübergreifendes Denken und gelingende Kommunikation. Diese Herausforderung ist in Theorie und Praxis noch nicht umfassend erschlossen.
Im Rahmen meiner 2011 mit summa cum laude abgeschlossenen Doktorarbeit „Integrierte Konfliktbearbeitung im Dialog“ entwickelte ich einen disziplinübergreifenden Ansatz zur Konfliktanalyse und -bearbeitung. Aktuell erforsche ich, wie die Kommunikation in interdisziplinären Teams verbessert werden kann, um bessere Problemlösungen und Entscheidungen zu ermöglichen. Meine Erkenntnisse finden sich unter anderem in meinen Büchern „Kommunikative Komplexitätsbewältigung“ und „Resilienz im Spannungsfeld zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit“.
Von 2019 bis 2023 engagierte ich mich im Zukunftskreises des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), wo wir Szenarien für die Zukunft Deutschlands und Europas analysieren und multiresiliente Strategien für unvorhersehbare Entwicklungen erarbeiten. Aktuelle Trendstudien finden Sie hier: Zukunft von Werten und Zukunftsthemen.
Auf dieser Grundlage begleite ich Teams und Organisationen aus Wissenschaft und Politik dabei, komplexe gesellschaftliche Themen inter- und transdisziplinär zu erfassen und nachhaltige Resilienzstrategien zu entwickeln.
Seit 2022 fokussiere ich meine Forschung verstärkt auf die Internationalen Beziehungen, mit besonderem Augenmerk auf aktuelle Konflikte wie den Russland-Ukraine-Krieg sowie den global aufkommenden „Neuen Kalten Krieg“ (siehe dazu auch mein Buch). Zentral dabei ist die Frage, wie wir aus diesem globalen Gefangenendilemma ausbrechen können – und genau hier kommt die Kraft von Kommunikation und kollektiver Intelligenz ins Spiel.
Meine Arbeit untersucht, wie durch gelingende interdisziplinäre Kommunikation und gemeinsames Denken neue Wege für Zusammenarbeit und friedliche Konfliktlösungen eröffnet werden können. So wird aus komplexer Herausforderung eine Chance für nachhaltigen Frieden und multiresiliente Gemeinschaften.
Dr. Karim Fathis Forschungsthemen im Überblick
Empathie 3.0 - Wie wir Stressfähigkeit und Einfühlsamkeit in Einklang bringen können
Empathie gehört heute zu den kontrovers diskutierten Kompetenzen. In einer zunehmend vernetzten Welt ist sie unerlässlich, um die Auswirkungen unternehmerischer und politischer Entscheidungen besser einzuschätzen und verantwortungsvoll zu handeln. Gleichzeitig birgt Empathie das Risiko emotionaler Ansteckung, die sich über soziale Medien unkontrolliert und massenhaft verbreiten kann. Angesichts wachsender Stressbelastungen und Reizüberflutung wird Empathie von manchen Forschenden sogar als hinderlich empfunden – sie plädieren für das Gegenteil.
Doch schließen sich authentisches Einfühlungsvermögen und Widerstandskraft gegenüber digitalen Resonanzkatastrophen und Stress wirklich aus? Wenn nicht, wie lässt sich diese neue Form der Empathie definieren und fördern?
Die Antwort liefert „Empathie 3.0“: eine in uns allen angelegte, auf Achtsamkeit, innerer Zentrierung und emotionaler Weisheit basierende Universalkompetenz. Sie bildet einen zentralen Baustein meiner Beratungs- und Coachingpraxis. Ein umfassendes Konzept zur Entwicklung von Empathie 3.0 finden Sie in meinem Ratgeber „Das Empathietraining“.
Multi-Resilienz - Wie wir uns wirksam gegen die Vielfalt von Krisen schützen können
Angesichts der Vielzahl aktueller Krisen auf organisationaler und gesellschaftlicher Ebene wird „Resilienz“ oft als universelle Antwort diskutiert. Doch was bedeutet es konkret für ein kollektives System – etwa eine Organisation oder Gesellschaft –, gegenüber ganz unterschiedlichen und zugleich unvorhersehbaren Ereignissen wie Finanzkrisen, Naturkatastrophen, Cyberterrorismus, disruptiven Marktentwicklungen, der Coronapandemie oder internationalen Konflikten widerstandsfähig zu sein?
Aus Forschungsperspektive ist klar: Solche Fragestellungen erfordern einen disziplinübergreifenden Ansatz. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich meine Forschung auf Chancen und Grenzen eines transdisziplinären Resilienz-Konzepts sowie dessen praktische Relevanz für krisenfeste Organisationen und Gesellschaften.
Auf Basis von Erkenntnissen aus Systems Thinking und dem Integrative Thinking habe ich fünf zentrale Pfeiler entwickelt, die Orientierung geben, wie Gesellschaften und Organisationen Multiresilienz aufbauen können. Multiresilienz bezeichnet dabei die Fähigkeit eines Systems, auf vielfältige, gleichzeitig auftretende Herausforderungen flexibel und wirkungsvoll zu reagieren.
Detaillierte Überlegungen zu diesem Thema finden Sie in meinem Sachbuch „Resilienz im Spannungsfeld zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit“.
Wie Kommunikation Komplexität beherrschbar macht
In unterschiedlichsten Konstellationen treffen Wissens- und Entscheidungsträger:innen aus Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um gemeinsam komplexe Probleme zu bearbeiten. Forschungsgruppen, Think Tanks, Performance Teams, Konferenzen oder Multi-Stakeholder-Dialoge sind nur einige Beispiele dafür.
Dies stellt nicht nur eine kognitive, sondern vor allem eine kommunikative Herausforderung dar. Wie können sich beispielsweise ein Soziologe, ein Architekt und ein Ingenieur, die gemeinsam an einem Forschungsprojekt zur Zukunft der Stadt arbeiten, effektiv verständigen?
Die Antwort auf diese Frage könnte entscheidend dazu beitragen, neue Einsichten zu gewinnen und bessere Entscheidungen in vielen aktuellen Problemfeldern zu treffen. Denn die Problemlösungsfähigkeit eines kollektiven Systems – sei es ein Team oder eine Organisation – wächst maßgeblich mit der Qualität seiner internen Kommunikation.
Weiterführende Gedanken dazu finden Sie in meiner Publikation „Kommunikative Komplexitätsbewältigung“.
Der Neue Kalte Krieg, globale Konflikte und multiparadigmatische Friedensforschung
Aktuelle hochbrisante territoriale Konflikte, wie der Russland-Ukraine-Krieg, sind Ausdruck tieferliegender globaler Dynamiken. Sie sind eng verknüpft mit dem Entstehen eines Neuen Kalten Krieges und spiegeln ein globales Gefangenendilemma wider, das die Menschheit daran hindert, notwendige Reformen der Vereinten Nationen und eine zukunftsfähige globale Governance voranzutreiben.
In meiner Forschung analysiere ich diese Zusammenhänge multiparadigmatisch, indem ich traditionelle Gegensätze zwischen sicherheitspolitischem Realismus und pazifistischer Friedenslogik integriere. Ziel ist es, Friedensforschung weiterzuentwickeln und neue Wege für friedliche Konfliktlösungen und multilaterale Kooperationen zu erschließen.
Diese komplexen Fragestellungen skizziere ich ausführlich in meiner aktuellen Publikation, die über den konkreten Konflikt hinaus die Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Friedens- und Sicherheitsarchitektur beleuchtet.